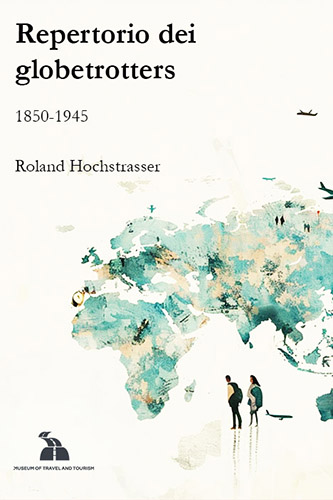Der geheimnisvolle Protagonist lässt sich in eine Diskussion mit einigen Clubmitgliedern verwickeln. Ausgehend von einem aktuellen Ereignis — dem Diebstahl von 55.000 Pfund — wird darüber debattiert, wie einfach es heutzutage für einen Dieb sei, in einer immer kleiner werdenden Welt zu verschwinden. Phileas Fogg nimmt schließlich die Wette an, die von Mr. Stuart vorgeschlagen und von den Herren Fallentin, Sullivan, Flanagan und Ralph unterstützt wird. Die Gentlemen wetten 20.000 Pfund darauf, dass es unmöglich sei, die Welt in 80 Tagen zu umrunden.
Fogg verlässt London noch am selben Abend und kehrt genau 80 Tage später, am 21. Dezember, als Sieger zurück. Um die Reise zu bewältigen, nutzt er eine Vielzahl von Verkehrsmitteln: Dampfschiffe, Eisenbahnen, Kutschen, Yachten, Frachtschiffe, Schlitten und sogar Elefanten. Jede Etappe ist voller unerwarteter Ereignisse und ungewöhnlicher Abenteuer, nicht zuletzt durch das beharrliche Eingreifen von Fix, dem Inspektor, der überzeugt ist, dass Fogg ein Bankräuber sei, und ihn auf seiner ganzen Reise verfolgt, um ihn zu verhaften.
Neben der literarischen Version ist auch die Bühnenadaption erwähnenswert, die Verne gemeinsam mit Adolphe d’Ennery erarbeitete. Am 7. November 1874 wurde das gleichnamige Stück im Théâtre de la Porte-Saint-Martin in Paris uraufgeführt — mit großem Erfolg, denn es lief ununterbrochen bis zum 10. November 1878.
Zusammen haben das Buch und seine Theaterfassung zahlreiche Generationen von Reisenden inspiriert und einen Bruch mit den bisherigen Reisevorstellungen markiert. Mit der Veröffentlichung von Vernes Werk und seiner fesselnden Bühnenversion erwachte ein wachsendes Interesse für das Thema: die Weltreise wurde zu einem Wettstreit zwischen Realität und Fiktion, an dem fiktive Figuren, Journalisten, Autoren und einfache Abenteurer teilnahmen.
Der berühmte französische Dichter und Regisseur Jean Cocteau, fasziniert von Foggs Abenteuern, unternahm zwischen dem 28. März und dem 17. Juni 1936 seine eigene Weltumrundung. Dazu schrieb er:
„Jules Vernes Meisterwerk mit seinem roten und goldenen Einband als Auszeichnungsexemplar, das Theaterstück mit dem roten und goldenen Vorhang des Châtelet — all das beflügelte unsere Kindheit und schenkte uns, mehr noch als ein Globus, die Liebe zum Abenteuer und die Sehnsucht nach dem Reisen.“
(Cocteau, Jean. Il mio primo viaggio. DeAgostini, 1964).
Berühmt geworden durch den legendären Phileas Fogg, erlebten die Globetrotter in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine wahre Blütezeit — eine Epoche, die von rasanten technologischen Fortschritten und wachsender Neugier gegenüber dem Unbekannten geprägt war. Globetrotter aus allen sozialen Schichten begaben sich mit Begeisterung — und oft auch mit Leichtsinn — auf Reisen in unbekannte Gebiete. Fantasievoll und furchtlos wagten sie die unwahrscheinlichsten Expeditionen mit oft improvisierten Mitteln und trugen so selbst zur weltweiten Etablierung eines neuen Reisebildes und einer neuen Vorstellung vom Reisen bei.
Globale Umbrüche und das Aufkommen der Globetrotter
Im historischen Kontext des 19. Jahrhunderts führten mehrere zentrale Innovationen im Transportwesen zu einer Revolution des globalen Reisens. Die erste transkontinentale Eisenbahn in den Vereinigten Staaten, die 1869 eingeweiht wurde, ermöglichte schnelle und sichere Verbindungen von Küste zu Küste. Im selben Jahr verkürzte die Eröffnung des Suezkanals die Schifffahrtswege zwischen Europa und Asien drastisch und erleichterte somit Handel und Erkundung. Gleichzeitig verbesserte der Ausbau eines einheitlichen Eisenbahnnetzes in Indien die Mobilität innerhalb des Subkontinents erheblich.
Die Erfindung des Verbrennungsmotors bedeutete einen weiteren Fortschritt im Verkehrswesen: Das Automobil, das sich ab Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete, machte das Reisen auf dem Landweg schneller und erschwinglicher. Eine besonders erwähnenswerte Leistung war das Autorennen von Peking nach Paris im Jahr 1907, das die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Automobilen auf Langstrecken unter Beweis stellte.
Auch die Luftfahrt trug wesentlich zur Erweiterung der Reisemöglichkeiten bei. Die ersten Flüge der Gebrüder Wright im Jahr 1903 ebneten den Weg für den Fernluftverkehr. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich die Luftfahrt rasant weiter – mit transatlantischen Flügen und Weltumrundungen, die die Welt noch zugänglicher machten. Die erste Weltumrundung mit dem Flugzeug wurde 1924 von einem amerikanischen Team durchgeführt. Diese Leistung – deutlich langsamer als jene, die Jules Verne beschrieben hatte – dauerte 175 Tage, in denen 42.400 Kilometer zurückgelegt wurden: von Osten nach Westen über den Pazifik, Asien, Europa und den Atlantik.
In diesem dynamischen Kontext, der von tiefgreifenden technologischen und sozialen Veränderungen geprägt ist, lassen sich die Geschichten der Globetrotter verorten – ein Phänomen, das häufig vergessen oder bestenfalls in Fußnoten der großen sozial- und wirtschaftshistorischen Werke erwähnt wird. Und doch wagten sich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert Tausende von Weltenbummlern in die abenteuerlichsten Unternehmungen, oft ohne angemessene Vorbereitung oder ausreichende Mittel. Diese Mikrogschichten tragen in ihrer Vielfalt dazu bei, das touristische Phänomen sowie die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse aus einer neuen Perspektive zu verstehen.
Über Jahrzehnte hinweg waren Globetrotter flüchtige Berühmtheiten, die unerwartet in Städten und Dörfern auftauchten und dort – zumindest anfangs – auf beachtliches Interesse stießen. Das Phänomen zeigte viele Facetten und eröffnete Diskussionsräume für sensible soziale Themen. So wiesen etwa die ersten Reisen abenteuerlustiger Frauen auf eine neue gesellschaftliche Rolle der Frau hin. Ebenso unterstrichen die Unternehmungen Hunderter von Reisenden mit Behinderung den Wunsch, ihre Normalität in einer Gesellschaft zu behaupten, die jene ausschließt, die nicht bestimmten Normen entsprechen.
Die ab dem späten 19. Jahrhundert dokumentierten Abenteuer sind alles andere als einheitlich. Die von den Wanderern selbst erstellten Materialien sowie die Berichte in Zeitungen und Zeitschriften erzählen von Weltumrundungen, transkontinentalen Fußmärschen und vielfältigen Reiserouten – allein oder in Begleitung von Menschen oder Tieren, mit mechanischen Mitteln wie Fahrrädern, Motorrädern oder Autos. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Reisenden selbst wider: Männer, Frauen, Kinder, Neugeborene, alte Menschen. Getrieben von unterschiedlichsten Motivationen, präsentierten sie originelle oder banale, echte oder erfundene Projekte. Zu dieser bunt gemischten Gruppe gehört auch eine oft vergessene, aber bedeutende Kategorie im kollektiven Vorstellungsraum: die der imaginären Reisenden – Globetrotter, die aus literarischen Erzählungen hervorgingen und – wie Jules Verne meisterhaft demonstriert – zu paradigmatischen Figuren wurden, die bis heute eine unerschöpfliche Inspirationsquelle darstellen.
Die zerbrechlichen Spuren der Globetrotter: Ein unvollständiges Repertoire
Viele der im Repertoire enthaltenen Geschichten bleiben unvollständig und lassen sich nur schwer rekonstruieren oder überprüfen. Historisch gesehen war das Reisen oft mit einem ständigen Spiel der Tarnung verbunden – einer Technik, die nicht nur dazu diente, den Gefahren auszuweichen, die dem unvorsichtigen Reisenden auflauerten. Jede Reise kann eine verborgene Seite haben – bewusst verschwiegen oder unbewusst: "Der Reisende kann sich eine Vergangenheit erfinden, die er nie hatte; er kann seine wahre Identität auf tausend Arten verbergen, sie je nach Situation verheimlichen oder offenbaren. Er kann sich bemühen, sich an die Realität, die er durchquert, anzupassen, indem er Rolle und Status wechselt – aus spezifischen, oft gut begründeten Gründen oder einfach nur, um einen unmittelbaren, greifbaren Vorteil zu erlangen.“ (Mazzei, 2013)
Die Zeugnisse sind oft spärlich, widersprüchlich oder bruchstückhaft und machen es schwierig – wenn nicht unmöglich – genau zu bestimmen, wie viele Reisende tatsächlich das unternommen haben, was sie öffentlich behaupteten. Neben den lückenhaften oder unvollständigen Nachweisen gibt es auch Geschichten, die noch weniger Spuren hinterlassen haben, schwer auffindbar sind oder überhaupt keine greifbaren Spuren hinterließen.
In diesem Rahmen ist eine vollständige Erfassung offensichtlich nicht möglich. Doch eine partielle Wiedergewinnung verfügbarer Informationen kann helfen, ein bislang wenig bekanntes und wenig erforschtes Phänomen zu würdigen. Warum sich mit den Mikrogschichten flüchtiger Figuren beschäftigen und sie in einem Repertoire sammeln? Die Geschichten der Globetrotter erzählen auf andere Weise von der Geburt einer neuen Welt, in der das Reisen neue Bedeutungen annimmt. Ihr Handeln hilft uns, die Ausgangspunkte neuer Dynamiken besser zu verstehen – und vielleicht auch die Beweggründe, die diesen sozialen Praktiken zugrunde liegen. Die Reise erhält dabei einen doppelten Sinn: als Bewegung durch den Raum und zugleich als Weg durch die Zeit – ein Zugang zum gesellschaftlichen Wandel, gesehen durch die Augen jener, die ihn selbst erlebt haben.
Dieses Werk ist eine Hommage an jene Frauen und Männer, die sich auf unbekannte Wege begaben – oft mit notdürftigen Mitteln – und damit eine Faszination und ein Staunen auslösten, die bis heute ungebrochen sind. Eine verdiente Würdigung vonseiten jener, die heute komfortabel reisen können – gestützt auf ein umfassendes Netz schneller und effizienter Transport- und Servicedienstleistungen.
Das Repertoire ist ein unvollständiges Dokument – eine Baustelle, zu der alle eingeladen sind, beizutragen: neue Globetrotter zu melden oder Details und Korrekturen zu bereits erfassten Personen vorzuschlagen. Das erste Kapitel liefert Hintergrundinformationen zur Kontextualisierung des Repertoires. Im folgenden Kapitel sind die Globetrotter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt: Die Einträge enthalten die wichtigsten Informationen, eine kurze Zusammenfassung und Hinweise zur Vertiefung. Anschließend widmet sich der Text den fiktiven Figuren, die eine wesentliche Rolle bei der Förderung neuer Formen touristischen Konsums gespielt haben – und dies auch heute noch tun.
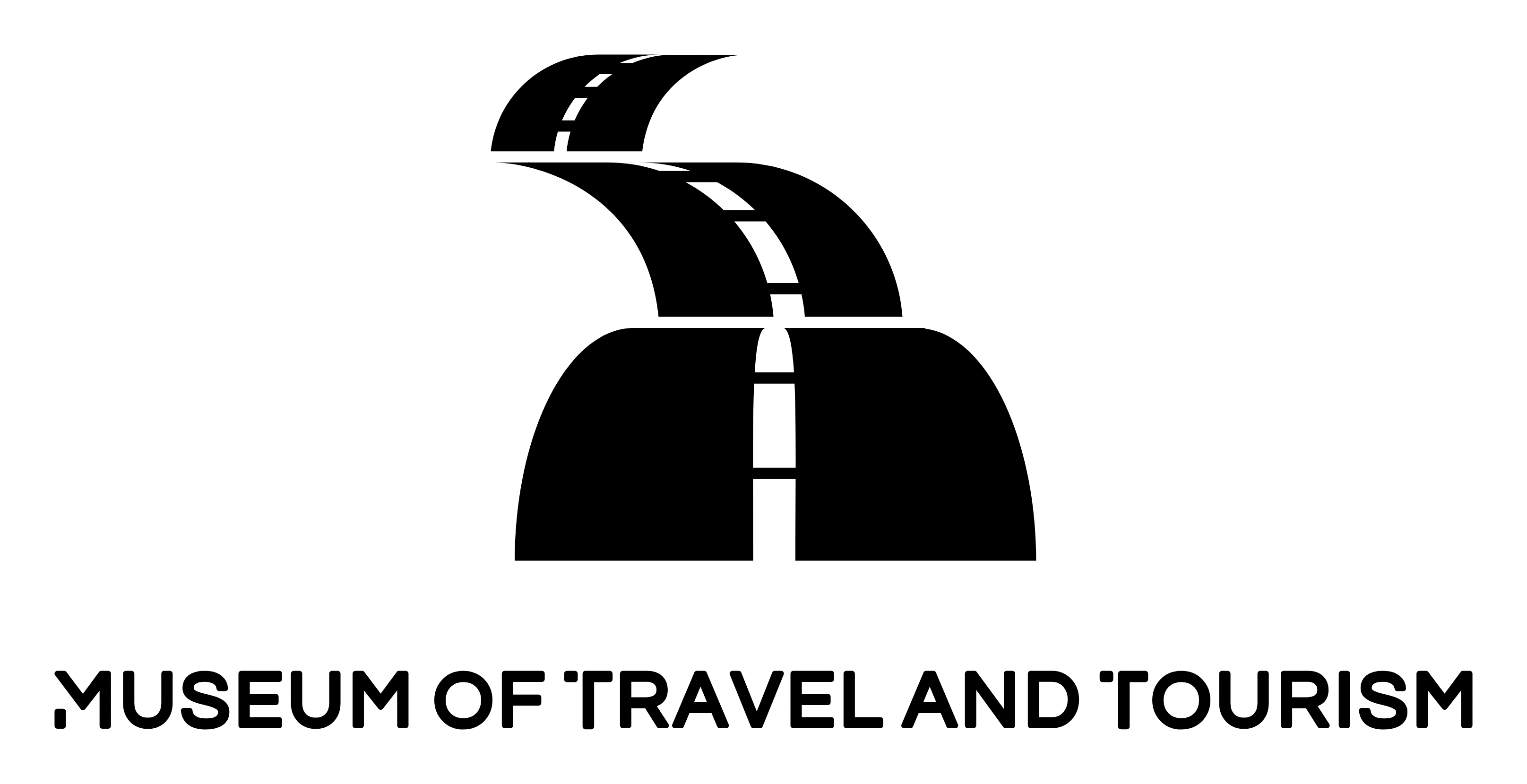
 IT
IT  FR
FR  DE
DE  EN
EN